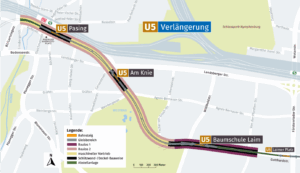„Man hört vier vernünftige Leute sich unterhalten, glaubt ihren Diskursen etwas abzugewinnen und die Eigentümlichkeiten der Instrumente kennen zu lernen.“ So formulierte Goethe 1829 seine Gedanken zum Streichquartett. Die Idee, instrumentale Kammermusik stelle eine Art Gespräch dar, hatte man aber schon deutlich früher u.a. auf das Streichtrio gemünzt. So schrieb der Komponist und Musiktheoretiker Johann Abraham Peter Schulz 1774 in Johann Georg Sulzers Enzyklopädie Allgemeine Theorie der Schönen Künste: „Das eigentliche Trio hat drey Hauptstimmen, die gegen einander concertiren, und gleichsam ein Gespräch in Tönen unterhalten. […] Gute Trios […] sind aber selten, und würden noch seltener seyn, wenn der Tonsetzer sich vorsezte, ein vollkommen leidenschaftliches Gespräch unter gleichen, oder gegen einander abstechenden Charakteren in Tönen zu schildern. […] Nur der, welcher alle Theile der Kunst mit einer fruchtbaren und lebhaften Phantasie verbände, und sich übte, jeden Zug eines Charakters oder einer Leidenschaft […] musikalisch zu empfinden, und in Tönen auszudrücken, würde eines solchen Unternehmens fähig werden, und das Trio zu der höchsten Vollkommenheit erheben.“
Diese Worte weisen schon auf die Gattungsbeiträge Wolfgang Amadeus Mozarts und Ludwig van Beethovens hin und leiteten bereits die Einladung für das Konzert mit Mitgliedern des Ensemble Isura am 9. Mai 2025, ebenfalls in der Kirche St. Wolfgang, ein. Beide Konzerte ergänzen sich in idealer Weise: Das Divertimento Es-Dur KV 563 diente zweifellos als Vorbild für das im Mai aufgeführte Streichtrio Es-Dur op. 3 von Beethoven und dessen letztes Streichtrio op. 9 Nr. 3 schließt das Streichtrioschaffen von Beethoven ab, im Mai war das Trio op. 9 Nr. 2 zu hören.
Das Divertimento Es-Dur KV 563 für Streichtrio ist das längste Kammermusikwerk von Wolfgang Amadeus Mozart, es entstand im September 1788 direkt nach der Vollendung der letzten drei Sinfonien, denen es an musikalischem Gehalt in keiner Weise nachsteht. Dennoch betitelte Mozart das Werk „nur“ als Divertimento, also Unterhaltungsmusik, vielleicht, um es seinem Logenbruder und Geldgeber Michael Puchberg schmackhafter zu machen. 1789 nahm er es mit auf die Reise nach Dresden, Leipzig und Berlin, im April wurde es in Dresden bei einem Kammermusikabend zusammen mit einem Dresdner Kantor an der Geige, Mozart an der Bratsche und dem Cellovirtuosen Anton Kraft, dem Adressaten von Haydns D-Dur-Cellokonzert, „so ganz hörbar executiert“, wie Mozart durchaus selbstbewusst an seine Frau schrieb. Auch in Wien fand es bald immer mehr Liebhaber, so spielte es Mozart an der Bratsche im April 1790 erneut zusammen mit dem Geige spielenden Bankier Johann Baptist von Häring und dem Solocellisten der Kaiserlichen Hofkapelle, Joseph Orsler. Dieses Divertimento führte Mozart also zusammen mit professionellen Musikern oder virtuosen Laien für einen Kreis hoch gebildeter Zuhörer auf, es ist eine hoch anspruchsvolle Unterhaltungsmusik.
Das Trio ist „in sei pezzi“, also in sechs Sätzen angelegt, wie Mozart in seinem eigenhändigen Werkverzeichnis vermerkte. Auf ein Allegro und ein Adagio, jeweils in Sonatenform, folgen ein erstes Menuett mit Trio, ein Variationssatz, ein zweites Menuett mit zwei Trios und ein Rondo. Der Aufbau entspricht damit exakt dem letzten Divertimento D-Dur KV 334, das Mozart in seiner Salzburger Zeit 1779 komponiert hatte. Über die virtuose Führung der Streichinstrumente hinaus sind aber alle Sätze umfangreicher, harmonisch reicher und kontrapunktisch kunstvoller gestaltet. Die drei Streichinstrumente sind gleichwertig, wie es Joseph Haydn in der Streicherkammermusik zum Prinzip erhoben hatte, jedoch mit einem deutlichen Zug ins Konzertante, den Mozart 1789 in seinen Preußischen Quartetten aufgreifen sollte. Teils ist die Violine Begleitinstrument, teils übernimmt die Bratsche die Bassfunktion und das Cello wird stellenweise in schwindelnde Höhen getrieben. „Es ist insgesamt ein höchst virtuoses Werk, das lange Zeit als unspielbar galt“, erklärt der Geiger Benjamin Schmid.
Der erste Satz verarbeitet neben zwei wunderschönen gesanglichen Themen eine kurze kontrapunktische Floskel in Engführung, das folgende Adagio in As-Dur, einer bei Mozart sehr seltenen Tonart, zählt zu Mozarts tiefgründigsten langsamen Sätzen.
Die beiden Menuette führen ins Tänzerisch-Volkstümliche: Das erste zeigt Scherzo-Charakter, einschließlich der bei Haydn so häufigen rhythmischen Verschiebungen, das zweite präsentiert sich mit Hornquinten in Dorfmusikanten-Manier, seine zwei Trios sind ein waschechter Ländler und ein Deutscher Tanz, der Vorläufer des Walzers.
Das Thema der Variationen in B-Dur erinnert an Volksmusik, die ausgedehnten Variationen zählen aber zu Mozarts kompliziertesten, am kunstvollsten ist die Mollvariation in b-Moll im doppelten Kontrapunkt.
Als Finale dient eines jener selig singenden Rondos im 6/8-Takt, wie sie Mozart auch in den späten Klavierkonzerten immer wieder geschrieben hat, ein prägnantes rhythmisches Tonrepetitionsmotiv verleiht dem Satz durch die kontrapunktischen Züge einen etwas widerspenstigen Charakter.
Die Streichtrios nehmen im Frühwerk Ludwig van Beethovens einen dominanten Platz ein, unter den Opera 1 bis 10 sind allein drei (op. 3, 8 und 9) dieser Gattung vorbehalten, wobei die drei Streichtrios op. 9 von 1798 zu den bedeutendsten Frühwerken Beethovens zählen. Dass er dies auch selbst so sah, wird schon in der Widmung an den irischen Grafen Johann Georg von Browne deutlich: „Wenn die Kunstprodukte, denen Ihr als Kenner die Ehre Eurer Protektion erweist, weniger nach der genialen Inspiration als vielmehr nach dem guten Willen, sein Bestes zu geben, beurteilt würden; so hätte der Autor die ersehnte Genugtuung, dem ersten Mäzen seiner Muse das beste seiner Werke zu präsentieren.“ Auch die Beethoven-Biographie von Thayer und Riemann ist voll des Lobes: „Keins von den bisherigen Werken kann sich an Schönheit und Neuheit der Erfindung, Geschmack der Ausführung, Behandlung der Instrumente usw. mit diesen Trios messen; sie überragen im ganzen sogar auch die bald nachher erschienenen Quartette (op. 18).“
Im Streichtrio c-Moll op. 9 Nr. 3 zeigt Ludwig van Beethoven geradezu symphonische Dimensionen, der Cellist Daniel Müller-Schott äußerst sich dazu so: „Das ist ein ganz besonderes Werk. Da gibt es wirklich Abgründe, die er da erkundet. Und ich finde, er sprengt darin quasi die Form des Genres Kammermusik, wie man es vorher kannte.“
Gleich den Eröffnungssatz prägt die für Beethoven typische abrupte Kontrastdynamik. „Da zeigt sich auch Beethovens Charakter“, so Müller-Schott. „Er wird ja als sehr eruptiv beschrieben, und diese Ausbrüche setzt er in seinen Noten wirklich eins zu eins um. Diese großen Kontraste sind einfach absolut einmalig.“ Der Satz beginnt unisono mit einem absteigenden Vierton-Motiv c-h-as-g, dem Motto des Satzes. Der Seitensatz startet dann in einer „falschen“ Tonart As- statt Es-Dur, um sich entlang immer neuer thematischer Gestalten zu einer vehementen Durchführung zu steigern, deren Wucht noch die Reprise beeinflusst und sie zu einer Art zweiter Durchführung umdeutet.
Das Adagio con espressione, das das Violoncello mit einer absteigenden Tonleiter in C-Dur beginnt, besticht durch alle Facetten der Dreistimmigkeit, schöne Melodik, ausgedehnte Violinsoli und harmonische Reize. Der Satz endet in vollkommender Ruhe.
Als Kontrast zu diesem Idyll bietet das 6/8- Scherzo (Allegro molto e vivace) eine rasante Jagd, bei der Melodien allenfalls wie Zaungäste aufklingen, eine irrlichternde Atmosphäre, die vielleicht nicht ohne Einfluss auf Mendelssohns Scherzo-Typus war. Dem steht ein friedliches Trio in der Dur-Variante C-Dur mit seiner schlichten, auf alle drei Spieler verteilten Melodie gegenüber.
Das stürmische Finale lebt vom Frage-Antwort-Spiel zwischen einer nervösen Triolen-Arabeske und einem Tanzthema in Vierteln. Die Spannung zwischen diesen beiden Elementen bleibt bis zum Schluss unaufgelöst. Der Seitensatz beginnt unerwartet in es-Moll, um erst spät die Dur-Variante zu erreichen. In der Durchführung steigern sich die Triolen zu einer rasenden Fahrt in die Tiefe, bis sie am Ende in eine scheinbar unbekümmerte Dur-Pointe umgedeutet werden. Auch dieser Satz schließt im Pianissimo, es bleibt letztlich ein offener Schluss.
Die Musiker*innen:
Kaho Takemoto (Violine) hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den erstenPreis beim 70. All Japan Student Music Competition Tokyo Division und den zweiten Preis beim National Finals. Außerdem erhielt sie den Großen Preis (Governor of Kanagawa Award) und den Preis für die beste Leistung beim 33. Kanagawa-Musikwettbewerb sowie den Semi-Grand Prix beim Kariya International Music Competition und den Zweiten Preis beim Osaka International Music Competition.
Sie hat als Stipendiatin an der Liechtenstein Academy teilgenommen und wurde mit dem Munetsugu Angel Fund Scholarship 2024 ausgezeichnet. Sie ist mit angesehenen Orchestern aufgetreten, darunter das Kanagawa Philharmonic Orchestra.
Nach ihrem Abschluss an der Musikhochschule, die der Musikfakultät der Universität der Künste Tokio angegliedert ist, schloss sie ihr Grundstudium an der Universität der Künste Tokio ab, wo sie nach ihrem Abschluss den Acanthus Music Award und den Doseikai-Preis erhielt.
Derzeit studiert sie an der Hochschule für Musik und Theater München und ist außerdem Stipendiatin des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks.
Kairi Fuse (Viola) wurde 1998 in Japan geboren und erhielt bereits im frühen Kindesalter Geigenunterricht. Er studierte zunächst Violine am Toho-Gakuen College of Music in Tokio bei Prof. Kumiko Eto und war parallel dazu an der Toho Orchestra Academy eingeschrieben.
Nach seinem Abschluss setzte er sein Studium ab September 2021 am Moskauer Konservatorium bei Prof. Sergey Kravchenko fort. Aufgrund der politischen Lage in Russland musste er dieses jedoch abbrechen. Auf Empfehlung von Prof. Ingolf Turban begann er stattdessen ein Bratschen-Studium in Deutschland. Seit Herbst 2023 studiert er Viola im Bachelorstudiengang an der Hochschule für Musik und Theater München, zunächst bei Prof. Nils Mönkemeyer, ab Wintersemester 2025 bei Prof. Hariolf Schlichtig. Dort erhält er zudem Unterricht u.a. in Kammermusik bei Prof. Rafaël Merlin, Prof. Dirk Mommertz und Prof. Silke Avenhaus.
In Japan wurde er mehrfach bei Violinwettbewerben ausgezeichnet; auch als Bratschist erhielt er einen ersten Preis bei einem Kammermusikwettbewerb. Er nahm an zahlreichen Meisterkursen in insgesamt sechs Ländern teil und erhielt wichtige künstlerische Impulse von Ingolf Turban, Daniel Gaede, Zakhar Bron, Kim Kashkashian und Nobuko Imai. Derzeit ist er neben seinem Studium in Bayern sowie in anderen Regionen Deutschlands als Musiker aktiv. Er erhält Förderung durch die von Yehudi Menuhin gegründete Organisation „Live Music Now“ München.
Kokoro Ryu (Violoncello), geboren in Tokio, begann im Alter von 4 Jahren mit dem Klavierspiel und im Alter von 9 Jahren mit dem Cellospiel. Sie wurde 2023 mit dem Antonio-Meneses-Preis ausgezeichnet und gewann 2023 das Student Music Concours of Japan in Tokio. Sie hat auch viele andere Preise in Asien und Europa gewonnen.
Im Alter von 12 Jahren wurde sie in die Purcell School für junge Musiker in London aufgenommen, und zwei Jahre später wurde sie ausgewählt, das Klavierquartett „Upon One Note“ von Oliver Knussen in der Elizabeth Hall im Jahr 2020 uraufzuführen.
Nachdem sie nach Tokio zurückgekehrt war, wurde sie an der Musikhochschule, die der Musikfakultät der Tokyo University of the Arts angegliedert ist, aufgenommen und erhielt bald darauf den New Artist Award der Tokyo International Association of Art sowie ein Vollstipendium derselben Vereinigung. Außerdem erhält sie ein Vollstipendium des STROAN-Projekts der Salamanca Hall.
Sie gab ihr Solodebüt im Herkulessaal in München mit den Jungen Münchner Philharmonikern und trat auch mit mehreren Orchestern in Japan auf.
Sie ist Mitglied von Live Musik Now München, Ozawa International Chamber Music Academy Okushiga, des Asian Youth Orchestra und Solocellistin des Junior Philharmonic Orchestra.
Sie ist mit Künstlern wie Oliver Herbert, Federico Agostini und Ayana Tsuji aufgetreten und hat bei den Professoren Wen-Sinn Yang, Kenji Nakagi, Masaharu Kanda, Lana Hsieung und Pal Banda, und Kammermusik mit Raphaël Merlin, Silke Avenhaus, Adrian Oetiker, und Dirk Mommerz studiert. Sie wurde außerdem von den Cellisten Antonio Meneses, Maria Kliegel, Robert DeMaine, Tamas Varga, Tsuyoshi Tutumi, Sadao Harada und Natalie Clein inspiriert.