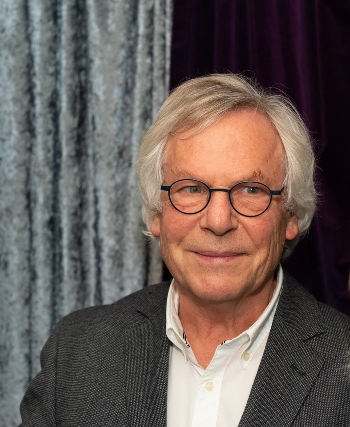„Ich bin 1895 zu Hanau geboren. Seit meinem 12. Jahre Musikstudium. Habe als Geiger, Bratscher, Klavierspieler oder Schlagzeuger folgende musikalische Gebiete ausgiebig „beackert“: Kammermusik aller Art, Kaffeehaus, Tanzmusik, Operette, Jazz-Band, Militärmusik. Seit 1916 bin ich Konzertmeister der Frankfurter Oper. Als Komponist habe ich meist Stücke geschrieben, die mir nicht mehr gefallen: Kammermusik in den verschiedensten Besetzungen, Lieder und Klaviersachen. Auch drei einaktige Opern, die wahrscheinlich die einzigen bleiben werden, da infolge der fortwährenden Preissteigerungen auf dem Notenpapiermarkt nur noch kleine Partituren geschrieben werden können…“ So beschrieb Paul Hindemith seine frühe Lebensphase in der „Neuen Zeitschrift für Musik“ im Juli 1922.
In den 20-er Jahren hatte er sich mit seiner expressionistischen Kompositionsweise zum „Bürgerschreck“ entwickelt. Obwohl sich dann seine Musik hin zu einer tonal deutlich konventionelleren Tonsprache verändert hatte, wurde sie vom Nazi-Regime als „entartet“ diffamiert, ab 1936 wurden Aufführungen seiner Werke in Deutschland verboten. In der Ausstellung „Entartete Musik“ in Düsseldorf 1938 wurde ihm ein ganzer Abschnitt gewidmet, er wurde als „Theoretiker der Atonalität“ und „jüdisch versippt“ beschimpft. Hindemith emigrierte deshalb noch 1938 in die Schweiz und zwei Jahre später in die Vereinigten Staaten.
Das Quartett für Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier wurde im März 1938 in New York begonnen, im April in Hamburg fortgesetzt und im Juni im schweizerischen Chandolin fertiggestellt, die Uraufführung fand im April 1939 in New York statt. Es war in den Jahren von 1936 bis 1943 Hindemiths einziges Ensemblestück neben einem Zyklus von Sonaten für ein Orchesterinstrument und Klavier.
Das Schwanken zwischen Kirchentonarten und Dur-Moll-Tonalität und eine kantable und lyrische Thematik bewirken eine elegische Stimmung, aus der man Abschiedsgedanken oder gar den Abgesang auf eine Zeit des Friedens herauslesen könnte.
Der erste Satz beginnt mit einem einstimmigen Klaviersolo, diese Ruhe prägt den ganzen Satz. Vor allem die Durchführung besticht durch eine für Hindemith typische kontrapunktische Verarbeitung. Der zweite Satz spannt einen großen Bogen, einem sehr melancholischen A-Teil folgt ein eher bedrohlich wirkender Mittelteil, dem dann wieder das Klarinettensolo des Anfangsteils folgt, jetzt aber durch das Pizzicato der Streicher und Arabesken im Klavier fast irreal erscheinend.
Der Schlusssatz besteht wie bei einem Potpourri aus vier unabhängigen Abschnitten. Der erste ist von einem synkopischen Thema geprägt, das fast an die „amerikanischen“ Melodien bei Antonín Dvořák erinnert. Dem folgt ein „lebhafter“ Gigue-artiger Tanz und ein „ruhig bewegtes“ Intermezzo, bevor eine stürmische Klavier-Toccata die lebhafte Coda einleitet. „Sukzessive steigern sich in diesem Satz die „modernen“ Anteile: dissonante Überlagerung, Klangballung und Disparates – so als habe Hindemith auskomponieren wollen, auf welche Zerstörungen seine Epoche hinsteuert.“ (https://www.kammermusikfuehrer.de/werke/916)
Eine große Überraschung für Bartók-Kenner dürfte dessen Klavierquintett sein. Ähnlich dem jungen Mendelssohn-Bartholdy hatte er eine Wunderkind-Karriere als Pianist und Komponist gemacht, laut eigener Zählung war er bereits 1899, also mit 18 Jahren, bei seinem Opus 20 angekommen. Darunter befand sich auch ein erstes Klavierquintett von 1897, dem bald ein weiteres folgen sollte. Bartók begann dieses im Oktober 1903 während eines längeren Berlinaufenthalts und beendete es im Juli 1904 in der Sommerfrische im ungarischen Landgut Gerlice-Puszta, wo auch seine ersten Volksliedaufzeichnungen entstanden.
Sein eben abgeschlossenes Studium an der Liszt-Akademie in Budapest bei dem deutschen Komponisten Hans Koessler hatte ihn mit dem Stil von Johannes Brahms vertraut gemacht und die Aufführung von „Also sprach Zarathustra“ 1902 unter der Leitung des Komponisten Richard Strauss in Budapest hatte ihn nachhaltig beeindruckt. Gleichzeitig begann Bartók jedoch auch, sich mit dem Konzept einer nationalen musikalischen Sprache auseinanderzusetzen, mit der er seine ihm äußerst wichtige ungarische Identität ausdrücken wollte.
So besticht das temperamentvolle Klavierquintett mit einem schwelgerischen, spätromantischen Tonfall, bewegt sich aber im Spannungsfeld zwischen den stilistischen Vorgängern und dem Wunsch etwas Neues zu schaffen, erkennbar durch harmonische Kühnheit und ungewöhnliche Rhythmen.
Das viersätzige Werk ist als einzelner, fortlaufender Satz komponiert, in dem mehrere Themen wiederholt erklingen. So lässt sich das mottoartige Eröffnungsthema in zwei Unterthemen teilen, das eine dient später im Adagio als Hauptthema, das andere ist das Hauptmotiv im Finale.
Während der erste Satz deutlich den Einfluss von Brahms zeigt, fesselt das Vivace mit unregelmäßigen Taktgruppierungen, wie sie später u.a. auch im Mikrokosmos auftreten. Laut David Cooper basiert das rhythmisch deutlich einfachere Trio auf einem ungarischen Lied namens „Ég a kunyhó, ropog a nád“ („Die Hütte brennt, das Schilf prasselt“).
Im Adagio ist durch ganztönige Skalenelemente ein typischerer Bartók erkennbar, Melodik und perkussive Härte des Finales lassen dann seine Volksmusikforschung erahnen, die in späteren Kompositionen zu seinem Markenzeichen werden sollte.
Der Uraufführung am 21. November 1904 in Wien mit Béla Bartók am Klavier folgte erst 1910 die ungarische Erstaufführung, gemeinsam mit seinem 1. Streichquartett. Am 7. Januar 1921 wurde eine überarbeitete Fassung aufgeführt und stürmisch umjubelt. Der Herausgeber dieser Notenausgabe berichtete: „Als ihm nach dem Konzert einige Zuhörer unbedachterweise mit der Bemerkung gratulierten, dass diese Musik ihnen besser gefällt als das, was er später geschrieben hat, geriet Bartók in wilde Wut und warf die Partitur in eine Ecke„. Bartóks Frau Márta Ziegler sowie Zoltán Kodály dachten sogar, Bartók habe das Werk vernichtet, erst im Januar 1963 wurde es von dem Bartók-Forscher Denijs Dille wiederentdeckt.
Ausführliche Künstlerbiographien finden Sie auf der Website der Bayerischen Staatsoper:
Hanna Asieieva: https://www.staatsoper.de/biographien/asieieva-hanna
Anna Maija Hirvonen: https://www.staatsoper.de/biographien/hirvonen-anna-maija
Clemens Gordon: https://www.staatsoper.de/biographien/gordon-clemens
Rupert Buchner: https://www.staatsoper.de/biographien/buchner-rupert-1
Andreas Schablas: https://www.staatsoper.de/biographien/schablas-andreas
Dmitry Mayboroda: https://www.staatsoper.de/biographien/mayboroda-dmitry
Wir freuen uns auf Ihren zahlreichen Besuch.
Mit besten Grüßen
Walther Weck und das Team der Kammermusik in Pasing